Vom Labor in den Orbit
24.11.2025
Stefanie Steinhauser stellte ihre Masterarbeit bei der Geographischen Gesellschaft München vor.
24.11.2025
Stefanie Steinhauser stellte ihre Masterarbeit bei der Geographischen Gesellschaft München vor.
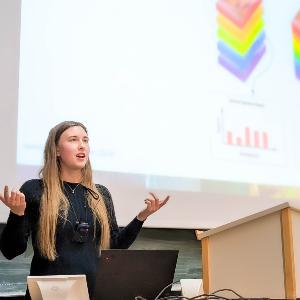
Beim zweiten Termin dieses Wintersemesters waren ehemalige Studierende unseres Departments bei der Geographischen Gesellschaft München dazu eingeladen, ihre Masterarbeiten zu präsentieren. Unsere Teamkollegin Stefanie Steinhauser stellte ihre und Prof. Tobias Hanks Arbeit zur deutschen hyperspektralen Satellitenmission EnMAP vor.
Was steckt hinter hyperspektraler Fernerkundung?
Fernerkundung bedeutet, Informationen über Objekte ohne direkten physischen Kontakt zu sammeln – über verschiedene räumliche Skalen hinweg: von Satelliten, Flugzeugen und Drohnen bis hin zu Messungen im Feld und im Labor.
Jedes Material reflektiert und absorbiert Licht auf seine individuelle Weise. Wenn wir dieses reflektierte Licht messen, können wir viel über das beobachtete Objekt herausfinden. Zum Beispiel:
Die meisten Satelliten messen nur wenige breite „Farbbänder“. Hyperspektrale Satelliten hingegen erfassen Hunderte sehr schmaler Bänder. Dadurch können sie winzige Unterschiede in den Spektralsignaturen von Pflanzen, Boden, Wasser und anderen Materialien erkennen.
Ein solcher Hyperspektralsatellit ist zum Beispiel die deutsche Erdbeobachtungsmission EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program), mit deren Daten Stefanie arbeitet.
Stefanies Forschung: Non-Photosynthetic Vegetation (NPV) im Blick
Stefanie konzentrierte sich auf ein Detail, das aus dem All oft übersehen wird: Non-Photosynthetic Vegetation (NPV). Zu NPV gehört braunes Pflanzenmaterial auf landwirtschaftlichen Flächen, zum Beispiel:
Auch wenn es unscheinbar wirkt – NPV spielt eine große Rolle in der Landwirtschaft. Es beeinflusst Bodenqualität und Humusaufbau, Erosionsrisiken, Wasserdurchlässigkeit und Nährstoffkreisläufe.
Zu wissen, wie viel NPV auf einem Feld liegt, hilft Landwirt*innen dabei einzuschätzen, wie es dem Boden geht. Das Problem: Satelliten tun sich schwer damit, NPV präzise zu erfassen, weil seine Spektralsignale subtil sind und sich leicht mit Boden vermischen.
Warum wir „Ground Data“ brauchen
Stefanies Ziel war es, diese NPV-Analysen mit Hilfe von in-situ Messungen zu verbessern. Dafür musste sie genau herausfinden, wie sich das Spektrum von NPV verändert, wenn nach und nach mehr Pflanzenmaterial aufgetragen wird.
EnMAP überfliegt jedoch denselben Ort nur etwa alle 27 Tage – viel zu selten, um kleine, inkrementelle Veränderungen zuverlässig zu messen. Deshalb brauchen wir Feldmessungen!
Weil Outdoor-Feldarbeit aber oft durch Wetter und Wolken gestört wird, baute Stefanie eine kontrollierte Laborumgebung auf. Sie
So erhielt sie eine präzise Referenz dafür, wie unterschiedliche NPV-Mengen im Spektrum aussehen.
Labor trifft Satellit: Daten verbinden, Muster erkennen
Stefanie wollte herausfinden, ob die feinen Spektralsignaturen aus dem Labor auch in großräumigen Satellitendaten erkennbar sind. Dafür:
Das Ergebnis: Die Satellitendaten zeigten tatsächlich die erwarteten Spektralsignale von NPV. Damit kann ihr Modell helfen, NPV über große Agrarflächen hinweg allein auf Basis von Satellitenbildern besser zu kartieren und zu verstehen.
Warum das wichtig ist
Stefanies Forschung hat viele praktische Anwendungen. Eine verbesserte Vegetationsanalyse per Fernerkundung kann dabei helfen:
Moderne Traktoren nutzen solche Daten bereits, um direkt auf dem Feld Empfehlungen in Echtzeit zu geben.